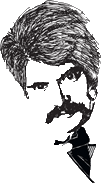James Brown
This is a man’s, man’s world
Er näselte heftig beim Sprechen. Auf eine Art, die mich abzuwägen zwang: Stil oder Deformation, verarmter Adel oder doch nur die Polypen. Aber ich kam nicht richtig ins Brüten darüber. Sein perkussives „Bitte“ hatte ich weniger als eine solche zu verstehen, denn als finale Aufforderung.
Mein Auto missfiel ihm. Stand zu dicht beim Eingang seines Restaurants.
Es strahlte nämlich.
Gewissermaßen.
Auf jeden Fall eine Aura aus, die dem Restaurant nicht stand.
Du magst vielleicht denken: vor Flensburg sind die doch alle gleich, aber: Irrtum. Was hier parkte, war Persönlichkeitsverlängerung. Insignium, nicht Effizienz. Design zählte, nicht Nutzlast.
Und nach einer Weile siehst du auch: eigentlich kein wirklicher Parkplatz hier. Eher Turnierplatz für einen Symbolkampf erster Güte. Ein stummer, stiller Kampf vielleicht, aber durchaus der Schwergewichtsklasse zuzurechnen. Hier: animalische Energie in Chrom und Blech, nur leidlich domestiziert; du wartest auf das frontale Brüllen der Großkatze. Oder dort: soviel militärische Virilität, wie das Zivilleben nur hergibt. Kaum eine Überraschung, würde eine vollständig ausgerüstete Kampfeinheit aus dem Vierradgetriebenen springen – nur halt von Armani und Gucci ausgerüstet, versteht sich.
Penaten, mobil und damit kühner geworden, finden ihren Platz auf Kühlerhauben. Computereinheiten die ihrigen hinter Mattglasabdeckungen im Inneren.
Mein alter Fiat – eher mit Symbolwirkung „coitus interruptus“ – hatte hier wirklich nicht zu stehen. Da musste man einschreiten.
Oder, wie in diesem Fall: einnäseln.
Denn egal, was die Gäste im Inneren verzehren mögen, das Restaurant zehrte vom Blech. Auf dem Parkplatz davor.
Drinnen dann war man unter Männern.
Früher oder später – du kannst drauf wetten – werden sie irgendwie unangenehm, die Männergesellschaften. Das passiert halt, wenn Testosteron Testosteron wittert. Du kannst schon froh sein, wenn nicht irgendwann alle in die Ecken rennen um ihr neues Revier zu markieren.
Ein Bemühtjovialer, der auf „Junge von nebenan“ machte, löste sich von seiner Gruppe.
An seinem Typ musste der noch dringend arbeiten, wenn du mich fragst. Das mit dem „nebenan“ kam höchstens hin, wenn du Nachbar des Schulungszentrums „Außendienstmitarbeiter des Jahres“ der vereinigten Versicherungen bist. Er kam neben mir zum Stehen, wartete – wie ich – auf den Service hinter der langgestreckten, fast den ganzen Raum durchmessenden Bar.
Welchen Wein sie denn heute ausschenkten, wollte ich von der Herannahenden wissen (und natürlich: wie die sich wohl fühlen mochte, in der Löwengrube purer Virilität – aber das traute ich mich nicht zu fragen). Mit einem Lächeln, das ich nicht zu deuten wusste zeigte sie mir die beiden in Frage kommenden Flaschen (alles andere gehe extra …). Ein Sauvignon mit einem Markennamen, zu dem sich im Kleingedruckten – fast schon schüchtern – Mondavi als Urheber bekannte und ein Cabernet Sauvignon. Natürlich. Diesmal aus Spanien.
Ich probierte den Sauvignon.
Der Seriöskumpel mit Weste neben mir auch. War nicht mein Fall: ein plumper Buhler, vordergründig, irgendwie aufgesetzt. Der Wein.
Der Dreiteiler auch. Gefallen wollte dem der Wein auch nicht. Ins Glas starrend schüttelte er – noch auf Fernsicht locker sichtbar – den Kopf.
Da stand dann wohl bald eine Cervikalstütze an, wenn der weiter so schüttelte. „Weine“, so verkündete er schließlich, „sind wie Frauen.“ Hatte ich’s nicht geahnt. Ich strich die 50 Euro ein, die ich mit mir gewettet hatte, dass das kommen würde.
Mit meinem Gesichtsausdruck, der die Frage an ihn suggerieren sollte, ob es sich hier um eine qualifizierte Vermutung oder um die quasi empirische Quintessenz seines bisherigen Lebens handele, lud ich ihn ein, mir weiter Saures zu geben. Ich brauche das manchmal.
„Frauen und Wein. Entweder“, so führte er seinen Aphorismus mit apodiktischer Gewissheit fort, „eine Trophäe oder ein Trostpreis.“ Erkenntnisgrund a priori vorausgesetzt hin, empirische Quelle her. Einfach nur gut klingen muss so ein Aphorismus. Und er selbst fand den Klang offenbar überzeugend. Denn beifallsheischend suchte er meine Augen. Die seinem Ohrfeigengesicht entschlossen auswichen: das Fiat-Syndrom. Du kannst keinen 7erBMW-Mann oder Lexus-Kutscher auf seinem Terrain schlagen – ebenso wenig, wie du sie auf der Autobahn überholen könntest. Möglich, dass sie die nächste schlüpfrige Kurve nicht kriegen und sich überschlagen. Möglich, dass sie sich einmal nicht mehr bremsen können. Aber das machen sie dann halt selbst. Du hast gegen die keine Chance.
Willst du etwa davon anfangen, dass die Verdinglichung der Frau durch den Mann letztlich – als Verdinglichung des Menschen durch den Menschen – auch ihn selbst ergreift und er sich somit zu einem Gegenstand unter Gegenständen macht? Da kannst du gleich Sanskrit reden. Ich ging in meine Ecke. Trophäe oder Trostpreis. Winner or Loser.
Mann, was für eine Welt.
James Brown fiel mir ein: „it’s a man’s, man’s world …“
Aber auch, was einem in so einer Welt so zwischen Trophäe und Trostpreis alles entgeht. Die Freunde nämlich, die sich gegen solche Kategorien sperren. Und alles andere eben außerhalb der mühsamen Symbolkämpfe.
„This is a man’s, man’s world“, aber wie sagt James zum guten Schluss: „He’s lost in the world of man. He’s lost in bitterness.“
Hört, Hört.