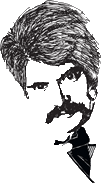Stellvertreterkrieg
Du armer Hund
„Ich will sehen, wie der Hund scheißt!“, kreischt es schneidend durch das geschlossene Fenster.
Das fliegt umgehend auf um den Blick auf eine Anfangssechzigerin im Blümchenkittel aus Dralon freizugeben. Unter ihrem über der Stirn geknoteten Kopftuch ringt eine beeindruckende
Betonfrisur nach Luft. Die in Gummihandschuhen steckenden Hände sind mit ihrem gegen die Genfer Konvention verstoßenden Gelbton ein geradezu hypnotisierender Blickfang.
Aus der linken Hand schlabbert tropfend ein grober wischwassergetränkter Putzlappen.
Natürlich lügt die gute Frau. Aus einem unbewussten Mechanismus heraus, einer Art sozialer Mimikri vielleicht.
Unmittelbarer Anpassungsdrang an eine Gesellschaft, in der Verdrängung, Verleugnung und Vertuschung akzeptable Vornamen sind. Vielleicht aber ist auch nur gerade ihre Grammatik in den Wischeimer gerutscht. Denn Tatsache
bleibt: sie will weder über die Kausalität noch über den Modus des diffizilen Entleerungsvorgangs der Caniden Aufschluss. Vielmehr ist es das ob, oder – noch dringlicher – das dass, das ihre Wissbegierde speist.
Sie wird bitter enttäuscht.
Der Hund – übrigens der meinige, der mit mir gerade die Einfamilienreihenhaus-Straße passierte – schiss nicht.
Macht der übrigens sowieso nur im Grünen. Da ist der ausgesprochen wählerisch. Denn wie für viele andere Hunde, ist für den das Absetzen von Verdauungsprodukten
einfach Kult. Das weiß Frau Blümchenkittel nicht – interessiert ja auch gar nicht. Sie will Blut, oder – in diesem Fall – einfach Scheiße sehen. Das braucht sie als finalen Interventionsgrund.
Denn hier tobt ein Krieg. Die sich durchsetzenden Standards des menschlichen Miteinander
gelten erst recht für tierisches Mitleben. Hinzu kommt, dass der persönliche Kessel dieser Tage mächtig unter Druck steht.
Keine Zinsen mehr für das kleine Ersparte.
Keine Trostmillionen für die Verluste bei den Aktien, die eigentlich die Altersvorsorge sein sollten.
Kurzarbeit.
Werksschließung.
Insolvenz.
Und das übliche persönliche Pech, das einem beispielsweise weiland die Abwrackprämie unerreichbar machte, da der Opel Astra vor dem Haus ein Jahr zu spät in die neunte Runde gegangen ist.
Das alles kann einem die Laune schon verhageln. Besonders, wenn in der Tagesschau die Übergabe des soundsovielten Milliardennachschlags zur Existenzsicherung einiger weiterer unserer –
spontan und nachhaltig unter Staatsschutz gestellten – Millionäre verkündet wird und die Feten im Bundeskanzleramt wieder mal ohne einen selbst stattfinden.
Klar, man sucht sich kleine Freuden.
Und so ein bissele Dampf ablassen muss man halt. Früher oder später sowieso. Dazu taugen die identifizierbaren Urheber des Schlamassels wenig. Zu weit weg. Zu hohe Zäune um ihre Privatinseln.
Und außerdem, seien wir doch ehrlich: die haben die es ja nicht absichtlich gemacht. Haben sich ja selbst so mächtig über die von ihnen produzierten Pleiten erschreckt, dass sie beinahe halsüberkopf weggelaufen wären. Die mussten doch mit Extraboni regelrecht beruhigt und zum Bleiben überredet werden.
Und trotzdem schleicht sich gelegentlich der Gedanke in die Köpfe, was wäre, wenn es eine Abwrackprämie für jene marktliberalen Spekulationsjunkies geben würde; nur die Bank, nur die Firma bekommt die Milliarden zugesteckt, die nachweisen kann, dass sie ihre Hazardspieler nachhaltig entsorgt hat.
Geschenkt.
Die gehören nun mal zu einem ordentlichen Liberalismus dazu, oder? Dass das Geld für diese Extraboni jetzt andernorts fehlt, ist durchaus für die meisten unpraktisch. Und erzeugt Druck. Auf den Kessel von Frau Dralonkittel, zum Beispiel.
Ablassen kann man den am besten dort, wo auch andere ihre Ventile öffnen.
Und da Hundehalter gemeinhin keine Unterstützung erhalten, ist hier ein 1a Opfer ausgemacht. Radikale Jungmütter, militante Rentner, stirnbeknoteter Kopftüchler mit Gummihandschuhen, ein breites Bündnis. Hier wird nicht lange gefackelt. Im Kampf gegen den internationalen Hundeterrorismus darf der Feind auch gerne mit an Wegesrändern eingesetzten Hausmacher-Fleischbällchen mit eingebackenen Rasierklingen befriedet werden. Rattengifttrüffelchen, mit Glasscherben panierte Leckerlies, der sado-kulinarischen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Frau Blümchenkittel, die gerade – für diesmal enttäuscht – ihr Fenster schloss, zieht energisch die Gardine vor und entfernt sich ins Innere der Wohnung.
Vermutlich um sich ein Gläschen Domestos zu genehmigen und eine Tirade über bakterienverseuchten Vierbeiner an das Wochenblättchen zu schreiben.
Mein Hund und ich gehen, einem auf dem Gehsteig zerschlagenen Flachmann ausweichend, kopfhängend unserer Wege.
Andreas Bürgel