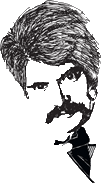„Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“
Obwohl Hegel mit keinem Wort erwähnt wird, fällt mir doch der olle GWF beim Hören des von Ulrich Matthes vortrefflich vorgelesenen Buches von
Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt
ein.
Mehr noch: er drängt sich mir förmlich auf.
Geht es doch um zwei Deutsche am Ende des 18. Jahrhunderts, die der bloßen Erscheinung endlich Wirklichkeit geben wollen. Und Erscheinung ist schlicht alles, was (noch) nicht vermessen, gewichtet, berechnet, kategorisiert und katalogisiert worden ist. Und ja, es war Hegel, der zuvor behauptete, dass „überhaupt das Dasein zum Teil Erscheinung und nur zum Teil Wirklichkeit ist“.
Dass die Vernunft demzufolge erst partiell realisiert ist. Aber an diesem Zustand lässt sich trefflich arbeiten, haben sich die genannten beiden deutschen Geister gesagt und losgelegt. Jeder auf seine Art. Wer nun glaubt, es handele sich hier um literarische Trockenkost, irrt gewaltig.
Spricht Hegel der bloßen Erscheinung der Dinge solange ihre Wirklichkeit ab, wie sie nicht mit ihrem Wesen eins sind, so ist die Welt für Carl Friedrich Gauß in Kehlmanns Roman schlicht und einfach derzeit stümperhaft eingerichtet und noch nicht in der Form vorhanden, wie es sein könnte und sollte. Das fängt an beim zähneziehenden Barbier – der schon mal einen gesunden Zahn mit dem maladen Beißerchen vertauscht und der in einer wirklichen, einer entstümperten Welt durch einen Facharzt zu ersetzen wäre – und hört auf bei noch ungelösten oder aber – schlimmer – unvollständig erfassten Problemen der Mathematik und Astronomie.
Alexander von Humboldt, dessen Vita den zweiten Erzählstrang in der „Vermessung der Welt“ bildet, ist in diesem Punkt – wie es mir scheint – weder Gauß noch Hegel fern: die Natur ist überall da, wo sie – von Preußen aus gesehen – in einem unbegriffenen Zustand ist, dem Menschen fremd, wild, erschrecken und zugleich gaukelnd, trügerisch.
Meinte Hegel, dass alles, was nicht „durch den Begriff selbst gesetzte Wirklichkeit ist … vorübergehendes Dasein, äußerliche Zufälligkeit, Meinung, wesenlose Erscheinung, Unwahrheit, Täuschung“ ist, schließt sich Humboldt auf seine Weise dieser Sichtweise an, indem er der Natur erst durch das exakte Vermessen, Wiegen und Berechnen Geltung zuweist.
Humboldt wie Gauß sehen die den Dingen anhaftenden Daten und Fakten als das Eigentliche, das Wesentliche an.
Humboldt geht bei Kehlmann sogar so weit zu behaupten, man könne die Menschheitsprobleme – explizit auch Kriege, Ausbeutung – dann recht einfach lösen, wenn nur eines Tages alle Daten auf dem Tisch lägen. Derart absolut erscheint ihm der Sicherheitsgewinn des Menschen in einer vermessenen und somit entwildeten und begreifbaren Natur.
Die andere Medaillenseite ist natürlich, dass die bloße Vorstellung vom unerforscht Nichtvermessenen genügt, um geradezu panische Angst zu generieren, Angst, die schnell umschlägt in Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst – im Kampf gegen das Unbekannte – und andere, die dieses Unbekannte bereit sind zu tolerieren.
Und ja: natürlich wissen die Helden des Buches, dass es nach ihnen weiter gehen wird, mit der Wissenschaft. Dass andere Anderes entdecken werden. Allein: der Gedanke, dass ihre Wissenschaft inder Erklärung der Dinge niemals erschöpfend zu erklären in der Lage sein könnte, wie diese Dinge sind, kommt nicht in den Sinn. Dann müsste ja auch vielleicht zugegeben
werden, dass Denken über den gegebenen, konkreten Gegenstand hinaus zielen muss, wenn er schon nicht in der Lage ist, ihn ganz zu erfassen.
Kultur, Kunst, Philosophie wie auch der psycho-soziale und emotionale Bereich des Menschen verkrümeln sich in solcher Weltsicht unweigerlich in den blinden Fleck der Wahrnehmung. Es fehlt ihnen hier der anwendbare Nutzen. Die Welt: reduziert auf die kahle Sprache und den Blicktunnel von Daten. Ein Gespräch über bildende Kunst, das Kehlmann die beiden Forscher im Umfeld des Deutschen Naturforscherkongresses 1828 in Berlin führen lässt, gerät erwartungsgemäß. Was nicht exakt das abbildet, was vermessen worden ist, ist nicht wert beachtet, geschweige denn geachtet zu werden. Es gehört verboten.
Warum denn hat man körperliche wie intellektuelle Mühen auf sich genommen – wie Humboldt mit seinem ihm doch recht ungleichen Kompagnon Bonpland die Welt bereist, Berge bestiegen, Höhlen durchkrochen, Gifte probiert oder wie Gauß vom Königreich Hannover aus den Weltraum berechnet – wenn dann doch jeder x-beliebige Künstler seine Gegenstände so malen kann, wie es ihm gerade so einfällt.
Musik übrigens erhält einen Nullstellenwert.
Und es mag zwar erheitern, aber nicht verwundern, dass Humboldt, während einer Flussfahrt gedrängt, etwas zu erzählen, eine – sagen wir: etwas knochige Version vom „Wanderers Nachtlied“ – zum besten gibt.
Bitte, hier: Humboldts Version des „schönsten deutschen Gedichts“, „frei ins Spanische übersetzt“:
„Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig, und bald werde man tot sein. Alle sahen ihn an. Fertig, sagte Humboldt. Ja wie, fragte Bonpland. Humboldt griff nach dem Sextanten.“
Lachen oder sogar die feinere Variante, das Lächeln, bleibt hier der Leserin oder dem Leser überlassen. Die beiden Protagonisten sind dem einen wie dem anderen fern. Der partielle Verlust der Kontrolle, somit Chaos, Wildheit liegt in diesen, ein Zustand, dem man ja gerade durch die Ordnung, die eine Zahl darstellt, beikommen will.
Aber doch, ein Preuße könne sehr wohl lachen, behauptet Kehlmanns Humboldt ernst:
„In Preußen werde viel gelacht. Man solle nur an die Romane von Wieland denken oder die vortrefflichen Komödien von Gryphius. Auch Herder wisse einen guten Scherz wohl zu setzen. Daran zweifle er nicht, sagte Bonpland müde.“
Kind im Hause Gauß oder Humboldt – das liegt nahe – möchte man nicht unbedingt sein. Kinder, das ist die Permanenz des Möglichen, das Unfertige, das Werdende und somit eben nicht exakt Fassbare. Sicherlich grauenhafte Wesen für Gauß, der konsequenterweise bei Kehlmann die Geburt seines ersten Kindes nicht verschläft, wohl aber ver-arbeitet. Nach einem Arbeitstag nach Hause kommend, bleibt die Bedeutung eines ihm zugetragenen Satzes wie: „es ist ein Junge“ trotz Anwesenheit des üblichen Geburtspersonals lange fern.
Gauß lernt aus den Reaktionen seiner Umwelt, die ihm dies als Fehler anrechnet und speichert das sozial als adäquat angesehene Verhalten im Geburtsfall – Blumengabe, Anteilnahme – zum Abruf für den Fall einer Zweitgeburt ab. Dabei aber bleibt es dann auch.
Dass so einer nicht nur einen nicht guten, sondern überhaupt keinen Familienvater abgeben kann, ist unzweifelhaft und wird bei Kehlmann besonders am Fall des Sohnes Eugen herausgearbeitet, dessen Schicksal den Vater niemals, auch dann nicht berührt, als dieser – trotz Kinderstube im Hause Gauß erwachsen geworden – infolge des Besuchs einer studentischen patriotischen Versammlung (höchst unterhaltend geschildert und auf den Punkt gebracht von Kehlmann) von der Geheimpolizei misshandelt und schließlich aus den deutschen Landen ausgewiesen wird – ein Umstand, an dem Vater Gauß sich als nicht unschuldig erweist.
Knorrig, misanthropisch, wissenschaftsgläubig, so forschen sich Gauß und Humboldt bei Kehlmann durch die Seiten.
Ohne Rücksicht auf Verluste. Da werden schon mal Hunde den Krokodilen vorgeworfen, wenn man einfach zu wenig Daten zum Jagdverhalten der letzteren hat. Da wird um um die Frage gerungen, was ein bestimmtes Amazonasgewächs definiert, der Frage nach der Definition des Menschen kommt man aber nicht näher, als man ihr durch die Beschäftigung mit Sterbestatistiken kommt. Das ist – sosehr sich alles in dieser partiellen Bestandsaufnahme auch auf den ersten Blick dagegen sperren möchte – komisch. Auf eine wüstensandtrockene Art komisch geschrieben ist es von Kehlmann allemal.
Die Vermessung der Welt ist somit nicht nur eine Doppelbiographie deutscher Geister und Faktensammlung erster Güte, sie ist auch und vor allem gute und perfekt gesetzte Unterhaltung.