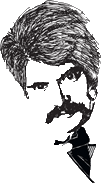Nomen Omen
Oder: Keine Gnade für Dixie.
Da waren diese beiden Mädchen, als die Kumpels und ich zum Campen nach Südfrankreich gefahren sind. Ariel und Marie.
Es war vielleicht gerade mal 1980 oder so; die uns und unserer Altersklasse angehängten Namen entstammten dem qualitätsgeprüften Michael-Andreas-Frank-Uwe-Stefan-Thomas-Susanne-Petra-Gabriele-Karin – Pool. Und da war plötzlich Ariel – und wir ein wenig durcheinander.
Klar, dass Marie erstmal beachtungsrelevant den Kürzeren zog.
Auch wenn sich bald herausstellte, dass sie die deutlich interessantere Person war.
Namen sind mit Erfahrungen verknüpft, und Erfahrungen prägen Vermutungen. „Bilz-Brause“ wurde in „Sinalco“ umbenannt, als jemand in der Firma zu zweifeln begann, dass die marktrelevanten Leute gerne bilzen würden. Dabei spielt es keine Rolle, dass niemand auch nur im Ansatz eine Ahnung hatte, was dieses Bilzen überhaut sein könnte. Der Name musste jedenfalls weg bevor herum war, dass man mit diesem Bilzen potentiell schlechte Erfahrungen machen könnte.
Du findest kaum Eltern, die den Namen „Lucifer“ für einen Sprössling in Erwägung ziehen. Obwohl der Name „Lichtbringer“ bedeutet. Dann nennen sie den schon lieber „Fynn“, was „der Vagabund“ heißt, oder „Louis“, wo schlicht keine Sau weiß, was der Name nun bedeuten soll.
In den letzten Schuljahren stieß ich auf eine Band namens „Dixie Dregs“.
Zu dieser Zeit teilten wir unsere musikalischen Erfahrungen regelmäßig und großzügig. Ein „willste mal hören“ gehörte zum Anlegen des Plattenspielerarms und erwartete so selbstverständlich keine Antwort, wie ein „wie sieht’s aus?“ zur Begrüßung. Dementsprechend platt war ich, als ich auf mein „Dixie Dregs, brandneu, willste mal …“ von einem Kumpel ein „Dixie? Äääh, nö, lieber nicht“ erhielt und auch das „ist aber Import“ nicht zog.
Das blieb kein Einzelfall.
Ich kam einfach nicht dazu, die Plattennadel in die Rillen zu legen – niemand wollte „Dixie Dregs“ hören, nicht mal ein Stück.
Schnell wurde offensichtlich, dass ich zu Mitbring-Feten, zu denen jeder seine Lieblingsscheiben anschleppte, nicht mehr eingeladen wurde.
„Der hört jetzt irgend so einen Benny-Goodman-Dixie-Scheiß oder so“, ging auf dem Schulhof schneller rum, als ein Magen-Darm-Virus im Spätherbst und dem Schulzahnarzt wurde größere Sympathie zuteil als mir. Was sich erst zu ändern begann, als ich 10 Tage hintereinander mit demselben Gallagher-T-Shirt zum Unterricht erschien, buchstäblich jede Unterhaltung auf die Fragen lenkte, ob Grobschnitt mit „Rockpommels Land“ den Progressive Rock entbritisiere und ob die Welt nach der Auflösung von „Kin Ping Meh“ möglicherweise besser dran sei.
Natürlich hörte ich die „Dixie Dregs“ weiter.
Aber nur im kleinen Kreis von Mitverschworenen.
Und der inoffizielle niedersächsische „Dixie Dregs“-Fanclub ging anlässlich der Veröffentlichung von „Dregs of the earth“ unter der neuen Plattenfirma (die alte war pleitegegangen) vollzählig feiern.
Alle drei Mitglieder.
Inkognito.
Manchmal frage ich mich, was wohl gewesen wäre, wenn sich die Band „Nirvana“ genannt hätte.
Oder „Pearl Jam“.