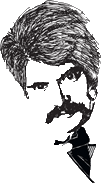Still crazy
Wir bringen die Band wieder zusammen
Es gibt Filme, die – zumindest namentlich – jeder kennt, aber kaum jemand sehen will.
Der umgekehrte Fall existiert natürlich nicht. Aber es gibt Filme, die zu unrecht unbekannt geblieben sind. STILL CRAZY gehört für mich unbedingt dazu.
Wer als Musiker schon einmal an einer Band-Reunion beteiligt war, kennt das berühmte Wechselbad der Gefühle, das hierbei entstehen kann. Wer schon einmal an einer Reunion einer Band beteiligt war, die weiland mal richtig gut drin war, im globalen Musikzirkus, die vor Jahren groß, und ich meine wirklich groß war, weiß, dass man in dieser Art Bäder ersaufen, oder sich neu getauft erleben kann – je nach dem.
Der Keyboarder Tony (Stephen Rea) und das ehemalige „Mädchen für alles“ Juliet (Karen Knowles) setzen so 20 Jahre nach dem letzten Gig einiges in Bewegung, um die Fruits wieder zusammen zu setzen. Das Puzzle bleibt dennoch unvollständig; der Gitarren-Heros Brian (Bruce Robinson) scheint nicht mehr unter den Lebenden und muss durch einen Outsider der Nach-Nachfolgegeneration (Luke, gespielt von Hans Matheson) ersetzt werden.
Die Band wird von der alten Plattenfirma zum Touren auf den „Kontinent“ geschickt. Bald schon klopft die Frage an die Tür des Second-Hand-Tourbusses, ob diese Fruits mehr sein können, als ein zerfallender Golem, der nur mühsam durch den alten Traum, Teil der kosmischen Musikbox zu sein, zusammengehalten wird.
Les hat immer noch daran zu knabbern, die Songs einem Ray zu überlassen, der so tief in seiner eigenen Version des Rock’n’Roll-Traums steckt, dass es schon mal vorkommt, dass er einem Pizzaboten, der die Lieferung quittiert haben möchte fragt, für wen denn die Widmung sein soll und der gut gemeinte Geburtstagswünsche mit einem frustriert-offensiven „Ich bin nicht 50“ abblitzen lässt. Und der Drummer Beano (Timothy Spall) scheint die Tour sowieso nur für einen Narrenzug durch die Irrealität zu halten. Einzige Realität scheint ihm die allgegenwärtige Bedrohung durch eine vermeintliche Steuerfahnderin, die sich selbst mit einem Coming-Out als 20 Jahre zu spät gekommenes Groupie auf die Seite der „Irrealität“ Beanos schlägt. Die Clubs sind, was die meisten sind: schäbige Löcher mit noch schäbigerem Backstagebereich. Das Publikum ist ein Publikum der Spätneunziger, das die Fruits höchstens vom T-Shirt-Aufdruck verstorbener Väter kennt.
Aber die Songs, wenn auch von einem durch die Vergangenheit ferngesteuerten Golem auf die Minibühnen gebracht, haben die Seele des Rocks in sich. Das Material ist richtig gut. Immer dann, wenn es der Band gelingt, die Vergangenheit zu begraben, werden die Fruits wieder lebendig und die einzelnen Musiker wieder zu dem, was sie fühlten zu sein, aber 20 Jahre wegschlossen. Und doch gelingt es den Fruits, sich im neuen Start ständig selbst auszubremsen. Die Vergangenheit ist ein Zombie. Durch Journalisten und Suff beschworen, erhebt sie sich, um nun ihrerseits die Früchtchen zu begraben.
Und das wäre es dann auch gewesen. Wenn nicht … ja, wenn nicht Juliet schließlich den schmerzlich vermissten Brian im Garten einer psychiatrischen Anstalt, deren Insasse er eine Zeit lang war, aufgestöbert hätte. Das schließlich im Finale auf großer Festivalbühne zelebrierte „The flame still burns“ bringt den ganz großen Spot auf diese Reunion, der man gerne – auch wider besseres Wissen – Dauer wünschen möchte.
Das klingt nach einem Musikerfilm. Das ist ein Musikerfilm.
Jedoch eher ein Film über Musiker und ihre Passion, als ein Film nur für passionierte Musiker.
„Too old to rock’n roll, too young to die“ hieß ein Album von Jethro Tull. Das beschreibt genau, was in den 70ern Credo war: Rock ist energisch, zehrend, fordernd, kompromisslos, Rock ist jung. Was aber tun, wenn man genau das geglaubt hat, genau so gelebt hat und plötzlich realisiert, dass der Rock und mit ihm seine genuinen Ikonen Patina angesetzt haben, alt geworden sind, dass die jetzt Jungen ihre Computer, Drum-Machines und oftmals geradezu lächerlichen Boy-oder Girl – Groups haben – und man selbst trotzdem gewiss ist, zu jung zum Sterben zu sein.
„Strange Fruit“, die Band im Film, war eine der großen des „Good Old English Rock’n Roll“, wie Ian Gillan mal die britische Rockszenerie nannte, und wurde in den 70ern beinahe weltberühmt. In dieser Band fanden sich keine auf welche Linie auch immer getrimmten Casting-Jüngelchen, hier prallten Individuen aufeinander, die sich in ihrer Musik bündelten und so eine überzeugende Einheit wurden. Aber eben nur hier, in der Musik, war diese Union möglich. Es waren die 70er, die Dekade der exzessiven Selbstsuche und so mancher Trip, der als Suche begann, endete … einfach nur im Exzess.
Rock’n Roll wurde nicht nur gespielt, er wurde gelebt.
Und dieses Leben gelangte häufig auf ein Schlachtfeld. Mehr als genug Heldentode mussten vermeldet werden. Auch Strange Fruit musste ihren Frontmann hinter sich lassen. Der Anfang vom Ende.
Bassist Les – gespielt von Jimmy Nail (der auch tatsächlich singt!) – , darf trotz großartiger Stimme nicht singen, der neue Sänger Ray – gespielt vom ebenfalls selbst singenden Bill Nighy – kommt mit dem Leben als Objekt der Fanbegierde mehr schlecht als recht klar.
Was sich da aufstaut, platzt mit einem Blitzschlag in die Bühne auf einem Open-Air.
Die Band bricht auseinander. Die Tantiemen halten nicht ewig.
Wer einmal mit Limousinen kutschiert wurde und dann selbst zum Taxifahrer werden muss, oder schlimmer: wer einmal von zehn-, fünfzig-, hunderttausend Menschen auf einer Bühne spielte und sich dann selbst auf dem Gehweg anonym inmitten einer Masse wiederfindet, der fühlt seine Psyche hart arbeitend Überstunden schieben, hört geradezu den Sand in seinem ganz persönlichen, inneren Getriebe.
Träume sind zum Trauma geworden. Die Fruits finden sich als Kondomverkäufer, Dachdecker, Gärtner, pleite gegangene Landhausbesitzer wieder.
Bis sie für ein Festival-Revival als Band aktiviert werden sollen.
Wer je irgend etwas mit dem „good old English Rock’nRoll“ anfangen konnte oder es heute noch kann, wird diesen Film schätzen.
Absolut großartig im Detail, atmosphärisch stimmig, authentisch und dabei vor allem: immer wieder schreiend komisch.
Mit Charakteren, die jedem, der mal in einem Tourbus einer Band gesessen hat, sofort bekannt vorkommen werden. Mit einem Plot, den der Rock’nRoll selbst geschrieben zu haben scheint.
Mühelos geht die Story ihren Weg, scheinbar sich nach ureigenen, inneren Gesetzen entwickelnd.
Die Musik ist auf den Punkt gebracht.
Der Sound der Band ist genau der, den man erwarten würde.
„School of Rock“ war sicher irgendwie nett. „Spinal Tap“ war schon richtig gut. STILL CRAZY aber bringt es auf den Punkt.